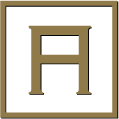In der Start-up-Szene herrscht derzeit ein beliebter Trend, zu gründen, idealerweise mit innovativen Ideen, beträchtlichen Investitionen und wagemutigen, möglicherweise sogar bahnbrechenden Produkten. Dabei vermeidet es jeder, an die Möglichkeit des Scheiterns zu denken.
Während gut funktionierende Start-ups und ihre brillanten Gründer gefeiert werden, bleibt die dunklere Seite oft unbeachtet – nämlich das Scheitern. Im Durchschnitt ist es so, dass etwa 80 % aller Start-ups innerhalb von drei Jahren nach ihrer Gründung bereits gescheitert sind. Diese Zahl ist bemerkenswert hoch, da es viermal so viele gescheiterte Start-ups gibt wie solche, die noch aktiv am Markt agieren.
Was führt dazu, dass Start-ups scheitern? Welche Fehler und Gründe spielen dabei eine Rolle? Und eine noch bedeutendere Frage ist, können wir aus diesen Erfahrungen lernen? Wir werden uns diesen Fragen widmen.
1. Warum geht der Nutzen oft verloren?
Die Marketing-Experten betonen immer wieder, dass der Kundennutzen an erster Stelle stehen muss. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Botschaft darüber, wie ein Produkt oder eine Dienstleistung das Leben der Kunden verbessert, sofort erkennbar und kommuniziert wird. Dieser Mehrwert sollte stets im Fokus bleiben. Jede Produkt- und Marketingstrategie sollte darauf ausgerichtet sein, den Kundennutzen zu maximieren. Ein häufig begangener Fehler besteht darin, dass Produkte von Anfang an keinen klaren Mehrwert bieten oder dass dieser im Verlauf vernachlässigt wird.
2. Just in Time
Die richtige Zeit für die Markteinführung ist entscheidend. Insbesondere in der Ära der Digitalisierung ist es von großer Bedeutung, eine vorausschauende Entwicklung zu verfolgen, um bei der Einführung nicht zu spät zu sein. Ebenso kann es passieren, dass Produkte zu früh auf den Markt gebracht werden und die Zielgruppen einfach noch nicht bereit dafür sind oder dass die notwendigen Infrastrukturen noch nicht vorhanden sind.
3. Die Auswahl der richtigen Partner
Die Wahl der richtigen Partner hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg eines Start-ups. Doch wie entwickelt man die richtige Strategie dafür? Obwohl die meisten Gründer darauf achten, dass ihre Partner-Kollegen Fähigkeiten mitbringen, die sie selbst nicht haben, hat sich gezeigt, dass die zwischenmenschliche Wellenlänge von entscheidender Bedeutung ist. Wenn man sich nicht versteht, können schnell Streitigkeiten und Antipathien entstehen, die häufig den Anfang vom Ende bedeuten.
4. Der Wunsch, alles selbst zu erledigen
Oft sind Gründer es gewohnt, alles selbst in die Hand zu nehmen. Doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem sie es alleine nicht mehr schaffen können oder Fähigkeiten benötigen, die sie nicht besitzen. Ob es um Marketing, Vertrieb oder Management geht, wer hier nicht beginnt, Aufgaben zu delegieren, loszulassen und auch in Personal zu investieren, läuft Gefahr, sich zu überfordern.
5. Mitarbeiterführung – ein unterschätztes Thema?
Das Thema Mitarbeiterführung ist für moderne Gründer oft ein unangenehmer Gedanke. Es klingt nach „Kindererziehung“. Dennoch ist es ein bedeutendes und wesentliches Thema, das häufig unterschätzt wird. Sich um das Team zu kümmern, es zu leiten, zu motivieren, klare Grenzen aufzuzeigen und die bestmögliche Leistung zu erzielen, erfordert eine gewisse Kunst. Nicht jeder ist von Natur aus dafür geeignet. Es ist ratsam, auf Teamleiter zu setzen, die Fachkenntnisse in diesem Bereich besitzen.
6. Finanzielle Herausforderungen
Egal ob es sich um eigenes Geld, Investorengelder oder Kredite handelt, in einem Start-up wird das verfügbare Kapital eingesetzt. Doch wenn man nicht erfahren und geübt im Bilanzieren ist, kann man sich leicht verkalkulieren. Investitionen könnten an falscher Stelle getätigt werden, Kostenfresser könnten übersehen werden oder es wird möglicherweise an der falschen Stelle gespart, anstatt das Geld gewinnbringend einzusetzen.
7. Der Weg der Vision
Als Start-up ist es entscheidend, ein klares Ziel zu verfolgen. Eine definierte Vision sollte existieren, die allen Beteiligten bekannt ist. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Geschäftsführer und Mitarbeiter den Fokus auf die Erreichung dieses Ziels richten. Als weitere Orientierung dienen Unternehmenswerte, die ebenfalls klar definiert und für alle zugänglich sein sollten. Es ist ratsam, regelmäßig zu überprüfen und zu analysieren, ob der Kurs tatsächlich in Richtung dieses Ziels führt. Denn ähnlich wie bei einer Autofahrt ohne eingegebenes Ziel ins Navi, kann man sonst schnell feststellen, dass man sinnlos umherfährt.
Wie mit Fehlern umgehen?
Fehler sind unvermeidlich und keineswegs selten. Wer niemals Fehler macht, macht wahrscheinlich etwas falsch. Denn nur durch Fehler lernt man und hat die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wichtig ist, dass man offen bleibt, sich selbstkritisch hinterfragt und flexibel ist. Rückschläge bedeuten nicht zwangsläufig das Ende, sondern sind vielmehr ein Ansporn, Veränderungen vorzunehmen und es in Zukunft besser zu machen. Das Scheitern von Start-ups gehört einfach zum Prozess.
Dann heißt es: weitermachen. Erfolg ist ein kontinuierlicher Weg. Gehen Sie ihn, wenn Sie an Ihre Idee glauben, und nutzen Sie jede Gelegenheit, um Neues zu lernen und zu wachsen – so wie es sich Start-ups wünschen.